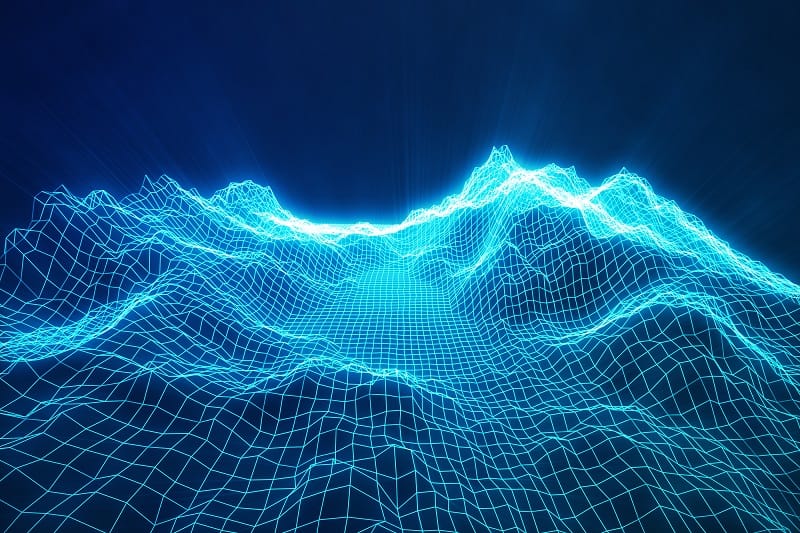Computer Vision, was ist das?
Dezember 13, 2021Mesh NetzwerkGlossar
Computer Vision ist eine Wissenschaft in den Bereichen zwischen Informatik und den Ingenieurwissenschaften und ist ebenfalls ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Computerbasiertes Sehen bezeichnet Systeme, die Objekte in digitalem Stand- und Bewegtbildmaterial identifizieren und dementsprechend verarbeiten und reagieren können. Computer Vision kombiniert Kameras, Edge- oder Cloud-Computing, Software und künstliche Intelligenz (KI), um Systemen das „Sehen“ und Erkennen von Objekten in Datenform zu ermöglichen. Computer Vision liefert eine wichtige Grundlage für Outside-In Tracking.
Zu diesen Daten können Fotos, Scans, Videos oder auch multidimensionale Daten, wie zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich zählen. In einigen Bereichen haben Maschinen mit Computer Vision sogar das menschliche Sehen und menschliche Leistungen übertroffen.
Gängige Aufgaben von Computerbasiertem Sehen sind die Erkennung von Objekten und Vermessung der Struktur von Dingen sowie von Bewegungen. Also die Grundlagen von AR/VR Anwendungen von Smartglasses bis zu Web-AR Anwendungen.
Die Geschichte von Computer Vision
Frühe Experimente fanden bereits in den 1950er Jahren statt. Die Experimente begannen 1959, als Neurophysiologen einer Katze mehrere Bilder zeigten und versuchten durch diese eine Reaktion in ihrem Gehirn zu ermitteln. Sie entdeckten, dass als erstes auf harte Kanten oder Linien reagierte, was wissenschaftlich gesehen bedeutet, dass die Bildverarbeitung mit einfachen Formen wie geraden Kanten beginnt. Das Herausstellen verschiedener Merkmale, wie Kanten und Ecken, war in den 1970er bis 1980er Jahren ein aktives Forschungsgebiet.
Mit der Entwicklung digitaler Kameras in den 1980er Jahren wurden immer mehr Programme getestet und entwickelt. Der Ausbau des Internets in den 1990er Jahren und die dadurch verfügbaren Bilder dort, die analysiert werden konnten, verhalfen der Gesichtserkennung zur Endentwicklung.
Das Feld der Computer Vision hat sich innerhalb der vergangenen zwanzig Jahre entscheidend weiterentwickelt: Heutige Computer-Vision-Systeme erreichen eine Genauigkeit von 99 Prozent und laufen inzwischen auch auf mobilen Geräten.
Wie funktioniert Computer Vision?
Die grundlegende Aufgabe des Computer Vision besteht darin, einer Kamera das Sehen und Verstehen beizubringen, die über eine Schnittstelle am Computer oder Endgerät angeschlossen ist.
Zunächst einmal benötigt der Computer ein aufgenommenes Bild. In diesem Bild muss eine Software dann Umrisse und Kanten erkennen können. Diesen ersten Schritt erledigt eine Programmierung, die Farbtöne und Kontraste analysiert und anpasst. Die Software kann so Kanten ausfindig machen und so Objekte erkennen und zuordnen.
Bei komplexeren Objekten werden oft zwei- oder dreidimensionale Modelle mit einbezogen.
Wenn ein Video analysiert wird, dann wird mit einer weiteren Gruppe von Methoden gearbeitet, um zu erkennen, ob das Objekt sich bewegt. Zu diesen Methoden gehört der sogenannte optische Fluss. Hierbei werden Bildpunkte einem Objekt zugeordnet und durch einen Vergleich der einzelnen Bilder kann schließlich bestimmt werden ob und in welche Richtung sich das Objekt bewegt.
In welchen Bereichen wird es angewendet?
Industrie und Ausbildung wendet die Techniken des Computer Vision in Kombination mit Spatial Computing heutzutage professionell und erfolgreich verwendet. Computer können Eigenschaften wie die Dichte von Beschichtungen messen, oder Produktionsfehler können frühzeitig erkennen und beseitigen. In vielen Industriebetrieben ist eine Qualitätssicherung mithilfe von automatisierter, optischer Inspektion bereits Standard. Hierbei entscheidet ein Computer auf Grundlage von Kameraaufnahmen und -bildern, ob etwas den Qualitätsstandards entspricht, oder nicht.
Besonders beim Autonomen Fahren werden hohe Anforderungen an Computer Vision gestellt, da selbstfahrende Autos Hindernisse erkennen und auf Gefahren reagieren müssen. Hier ist eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit nötig. Gleiches gilt für Roboter, Drohnen und weitere autonome mobile Geräte.
Doch auch im täglichen Leben findet jeder Computer Vision wieder, beispielsweise in der Maßband-App auf dem Smartphone, die ein Objekt erkennt und seine Dimensionen erfassen kann.
Auch die Einzelhandels-Branche erprobt und nutzt bereits Computer Vision. In „Go Stores“ erkennt ein Computer, wenn ein Kunde ein Produkt aus dem Regal nimmt oder zurücklegt. Das mit der Computer Vision verbundene Kassensystem rechnet den Einkauf automatisch über das Smartphone des Kunden ab.
Verschiedene Computer Vision-Typen
Durch die vielseitigen, verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Computer Vision, gibt es auch verschiedene Typen des maschinellen Sehens, die unterschiedlich zur Anwendung kommen können.
Es beginnt mit der Bildsegmentierung. Hierbei unterteilt die Software ein Bild in mehrere Bereiche, trennt es und untersucht es anschließend. In der Medizin unterstützt Computer Vision so die Detektion von krankem Gewebe in Röntgen- oder CT-Aufnahmen.
Die Objekterkennung dient zur Identifikation eines bestimmten Objekts innerhalb eines Bildes. Diese Modelle erstellen mit Hilfe einer X-Y-Koordinate ein Begrenzungsfeld und identifizieren alles innerhalb des markierten Feldes.
Automatische Gesichtserkennung
Eine weiterentwickelte Form der Objekterkennung ist die Gesichtserkennung. Mit dieser erkennen Kameras nicht nur Gesichter, sondern können – mit einer nicht zu unterschätzenden Fehlerquote – sogar Menschen identifizieren. Besonders da, wo Polizei und Ordnungskräfte Multikamera-Netzwerke verwenden, wie beispielsweise zur Überwachung und Kontrolle von Verkehrsknotenpunkten, dem öffentlichen Nahverkehr oder Flughäfen, kann diese Technologie einen großen Nutzen bieten. So helfen beispielsweise Algorithmen bei der frühzeitigen Erkennung von Gefahrensituationen oder bei der Erkennung von Personen innerhalb des Netzwerkes. Die Polizei benutzt das System auch bei Fahndungen.
Die Bildklassifikation dient zur Einordnung und Gruppierung von Bildern in gewisse Kategorien. Dabei können auch mehrere unterschiedliche Objekte oder Personen in einem Bild erkannt und gruppiert werden.
Die Bewegungsanalyse ist eine weitere Aufgabe des Computer Vision. Hierbei kommt dessen Teilgebiet, die Egomotion zum Einsatz. Diese schätzt die Kamerabewegung relativ zur dreidimensionalen Umgebung ab. Dies ist beispielsweise bei autonom fahrenden Autos entscheidend. Die semantische Aufschlüsselung in 3D-Daten ermöglicht es, zusammenhängende Strukturen zu erkennen, zuzuordnen und zusammenzusetzen.
Ein bestimmtes Problem im Bereich der Bildverarbeitung kann leicht mit einer zugeschnittenen statistischen Methode gelöst werden, während ein anderes Problem eine große und komplizierte Einheit von allgemeinen maschinellen Lernalgorithmen benötigt.
Einfachen Anwendungen, die Computer Vision nutzen, arbeiten in der Regel nur mit einem der Verfahren. In hochentwickelten Bereichen, wie beispielsweise autonom fahrenden Autos werden mehrere oder alle Verfahren kombiniert, um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten.
Computer können immer besser sehen
Durch ständige Forschung und Weiterentwicklung wird Computer Vision immer präziser und zuverlässiger. Jetzt bereits kann Computer Vision es in zahlreichen Fällen mit dem menschlichen Hirn aufnehmen.
Verbesserte Algorithmen und neue Technologien wie ein Rundum-Blick um das autonom fahrende Fahrzeug oder eine mehrgipflige Sensordatenfusion lassen sich bereits heute in Unterstützungssysteme einbinden, um die KI und den Menschen zu unterstützen.
Durch die Möglichkeit des Transfer Learning können mittlerweile auch Anfänger und Laien Computer Vision zum Einsatz bringen und auch ebenfalls durch die Weiterentwicklung von Frameworks und Modellen.
Die Kombination aus maschinellem Sehen und maschinellem Lernen ermöglicht es Unternehmen, intelligentere Techniken einzuführen, die ihnen die Genauigkeit, Effizienz und das materielle Wachstum der Zukunft ermöglichen.
Bildnachweis: ©Sergey Nivens – stock.adobe.com
Du planst eine VR-, MR- oder AR-Anwendung – hast aber noch Fragen zur Umsetzung?
Ob grobe Idee oder konkretes Konzept: Als XR-Experten bieten wir dir eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir begleiten dich gerne – von der Beratung bis zur professionellen Umsetzung.
Du interessierst dich für die Entwicklung einer VR oder AR Applikation? Du hast vielleicht schon eine konkrete Idee oder bist noch auf der Suche nach Inspiration? Mache heute den ersten Schritt und erhalte Antworten auf deine Fragen:
Unsere VR-Experten helfen dir gerne bei einer unverbindlichen Einschätzung deines Projekts! Erfahre jetzt alles was du wissen musst, um deine Firma oder Organisation in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität zu führen. Es lohnt sich!
Das Mesh Netzwerk erklärt
Dezember 9, 2021Mesh NetzwerkGlossar
Ein Mesh-Netzwerk verhindert "tote Stellen" in einem WLAN-Netzwerk. Sender sind so in einem Raum verteilt, dass sie ein Netz bilden. Dieses Netz stellt sicher, dass im gesamten Netzwerk eine gleichbleibend gute Verbindung zum Netzwerk besteht.
Bei einem gewöhnlichen WLAN-Netzwerk verteilt ein einzelnes Gerät, der Router, den Empfang im gesamten Wohn- oder Arbeitsraum. Das kann oft zu “toten Stellen” führen, an denen es keinen WLAN Empfang gibt, da der Router für den gesamten Wohnbereich zu schwach ist. Ein Mesh-Netzwerk schafft Abhilfe, weil es mittels diverser Zugangspunkte eingerichtet ist, die den kompletten Wohn- oder Arbeitsbereich abdecken. Mehrere verteilte Geräte erzeugen mehrere WLAN-Netze und fassen sie zu einem einzigen Netz zusammen – wie Maschen. Dieses sorgt für eine flächendeckend gleichbleibende Datenübertragungsrate.
Wie funktioniert das Mesh-Netzwerk?
Ein WLAN Router hat eine durchschnittliche Reichweite zwischen zehn und 20 Metern, wobei das Signal oft durch dicke Wände oder signalstörende Geräte wie Fußbodenheizung oder Babyphones schon deutlich früher abschwächen kann.
Zusätzlich zum normalen WLAN-Router wird ein ergänzendes Mesh-Gerät eingesetzt. Dies kann ein weiterer kompatibler Router sein, oder ein “Repeater”. Diese fangen das Signal auf und verstärken es an dem Punkt, wo sie angebracht sind, um das WLAN für den Rest des Wohnbereichs zu verstärken.
Repeater oder Access Point?
Wenn der WLAN Router an seine Grenzen kommt, wird oft ein Repeater als schnelle Lösung zwischengeschaltet. Bei Repeatern handelt es sich um Kopplungselemente, die Übertragungsstrecken in Netzwerken verlängern. Sie fungieren also wie ein eigener Hotspot, in den man sich separat einloggen muss. Das Problem bei Repeatern ist jedoch, dass sie für alle ein- und ausgehenden Daten denselben Kanal verwenden. Dadurch wird die Übertragungsgeschwindigkeit halbiert und die Netzwerkgeschwindigkeit verlangsamt. Das kann zu einer merkbaren Latenz führen.
Bei Access Points ist es etwas anders. Sie erhalten innerhalb des Mesh Netzwerks die gleiche Kennung, den SSID. Sie verbinden das Endgerät automatisch mit dem Knotenpunkt, der den stärksten Empfang zum Router hat. So erhält man unterbrechungsfreien Zugang zum Netzwerk. Man kann beliebig viele Access Points in das Mesh-Netzwerk hinzufügen, um so die Netzabdeckung zu erweitern.
Vorteile eines Mesh Netzwerks
Im drahtlosen Mesh-Netzwerk sind alle Access Points miteinander verbunden und vernetzt, weshalb das Netzwerk bei einem Ausfall eines Access Points nicht zusammenbricht. Die restlichen Router kompensieren den Ausfall der einzelnen Einheit und erhalten das WLAN innerhalb des Netzwerkes aufrecht.
Die Verwaltung des Mesh läuft drahtlos und ist nicht ortsgebunden, was eine besonders einfache und praktische User Experience zur Folge hat. Die Installation ist ebenfalls simpel, da der Mesh-Router oder Access Point an einer beliebigen Stelle platziert und installiert wird. Bei der Konzeption wurde also an alles gedacht.
Mögliche Nachteile
Mesh-Netzwerke mit einem kompatiblen Router sind Hersteller gebunden. Sollte man von einem bestimmten Hersteller einen WLAN-Router besitzen, so sollte man sich von diesem Hersteller auch den Access Point kaufen, da sonst eine Kompatibilität nicht garantiert werden kann. Dies kann auch oft mit höheren Kosten verbunden sein. Also nicht nach Optik entscheiden und einen Router kaufen, nur weil der Hersteller eine schicke Corporate Identity hat, die zu den Vorhängen passen.
Besonders sind die Kosten auch mit dem erhöhten Stromverbrauch verbunden, da natürlich mehrere Access Points auch mehr Energie benötigen.
Einsatzgebiete des Mesh
Das Mesh-Netzwerk ist längst Teil des Alltags eines Jeden geworden. Besonders in großen Städten kann es gefunden werden. Öffentliche Hotspots in der Stadt werden über das Mesh aufrechterhalten und erweitert, sodass Großstädte oft über ein flächendeckendes öffentliches WLAN-Netzwerk verfügen. Ebenfalls findet sich das Mesh in Kaufhäusern oder Einkaufszentren, die ihren Kunden kostenfreies WLAN zur Verfügung stellen.
Universitäten und Schulen bieten mittlerweile oft auch auf dem gesamten Gelände WLAN an. Gleiches gilt für Büros, Industrie- und Lagerhallen.
In der Touristik und der Gastronomie ist das Mesh-Netzwerk schon lange ein Teil des Geschäfts. Hotels, Kreuzfahrtschiffe, Restaurants, Flughäfen und Bahnhöfe bieten in den meisten Fällen WLAN auf dem gesamten Gelände an, welches durch das Mesh-Netzwerk gespeist wird.
Doch auch im Privatbereich ist das Mesh sehr sinnvoll und nützlich, besonders wenn man eine große Wohnung, ein Haus und dazu noch ein Grundstück besitzt, oder sich in der Wohnung dicke Betonwände oder Geräte befinden, die das Signal stören können.
Grob gesagt ist Mesh WLAN eine sinnvolle Wahl, um vielen Netzwerkgeräten ein großflächiges WLAN-Netz zur Verfügung zu stellen, ohne die Bandbreite zu beschneiden.
Du planst eine VR-, MR- oder AR-Anwendung – hast aber noch Fragen zur Umsetzung?
Ob grobe Idee oder konkretes Konzept: Als XR-Experten bieten wir dir eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir begleiten dich gerne – von der Beratung bis zur professionellen Umsetzung.
Du interessierst dich für die Entwicklung einer VR oder AR Applikation? Du hast vielleicht schon eine konkrete Idee oder bist noch auf der Suche nach Inspiration? Mache heute den ersten Schritt und erhalte Antworten auf deine Fragen:
Unsere VR-Experten helfen dir gerne bei einer unverbindlichen Einschätzung deines Projekts! Erfahre jetzt alles was du wissen musst, um deine Firma oder Organisation in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität zu führen. Es lohnt sich!
Was ist ein ARToolKit?
Dezember 9, 2021ARToolKitGlossar
ARToolKit ist eine frei erhältliche Computer Vision Tracking Bibliothek, die die Erstellung von Augmented Reality Anwendungen ermöglicht, die virtuelle Bilder über die reale Welt legen kann. Dazu nutzt das Programm Video-Tracking-Funktionen, um die reale Kameraposition und -ausrichtung zu quadratischen physischen Markern in Echtzeit zu berechnen.
Sobald die reale Kameraposition bekannt ist, kann eine virtuelle Kamera an der gleichen Stelle positioniert und 3D-Computergrafikmodelle erstellt werden, die die reale Markierung exakt überlagern. ARToolKit löst also zwei der Hauptprobleme der Augmented Reality: die Verfolgung des Blickpunkts und die Interaktion mit virtuellen Objekten in der Realität.
Die Entwicklung des ARToolKit
ARToolKit wurde ursprünglich von dem Japaner Hirokazu Kato im Jahr 1999 am Nara Institute of Science and Technology entwickelt und später vom HIT-Labor der University of Washington veröffentlicht. Derzeit wird es als Open-Source-Projekt auf SourceForge gepflegt, wobei kommerzielle Lizenzen von ARToolWorks ebenfalls erhältlich sind. ARToolKit ist eine sehr weit verbreitete AR-Tracking-Bibliothek mit über 160.000 Downloads seit 2004.
Was macht das ARToolKit so besonders?
ARToolKit war eines der ersten AR-SDKs für Mobiltelefone. Es lief zunächst 2005 auf dem Symbian Betriebssystem, dann 2008 auf iOS mit dem iPhone 3G und wurde schließlich 2010 auf Android eingeführt, mit einer professionellen Version von ARToolWorks im Jahr 2011.
Die Weiterentwicklung
Ben Vaughan und Phil Lamb, der ehemalige CEO und CTO von ARToolworks, haben ARToolKitX gegründet, um sicherzustellen, dass die Software weiterentwickelt und gepflegt und die ARToolKit-Community weiterhin unterstützt wird. ARToolKitX wird mittlerweile von Realmax Inc. unterstützt, einem chinesischen AR-Unternehmen, das AR-Hardware und -Software entwickelt.
Was kann das ARToolKit?
Das ARToolkit stellt für nicht kommerzielle Zwecke ein frei benutzbares Marker basiertes Trackingverfahren zur Verfügung, das von Programmieranfängern, sowie Personen mit Erfahrung im Programmieren benutzt werden kann. Alle benötigten Informationen finden sich in einer Bibliothek wieder, aus der die nötigen Funktionen und Anwendungspunkte ausgewählt und eingebettet werden.
In welchen Bereichen kommt es zur Anwendung?
Es ist schnell genug, um Augmented-Reality-Anwendungen in Echtzeit darzustellen und zu übertragen. ARToolKit verfügt über Positions- und Orientierungsverfolgung einer einzelnen Kamera und besitzt zusätzlich einen einfachen Code zur Kamerakalibrierung. Noch dazu ist das ARToolKit nicht abhängig von der Plattform, was bedeutet, dass es sich auf allen gängigen Betriebssystemen, wie Microsoft Windows, Linux, MacOS, iOS oder Android nutzen lässt. Des Weiteren ist es als Plugin für die Unity Game Engine verfügbar. Es enthält Erweiterungen für den Unity-Editor, mit denen man die erforderlichen AR-Objekte direkt konfigurieren, sowie eine Live-Vorschau der AR-Szene im Editor erzeugen kann. Ebenfalls ist es als Plugin für OpenSceneGraph erhältlich, was die Anwendung noch vielseitiger macht und ausweitet.
Das ARToolKitPlus
Das ARToolKitPlus ist der direkte Nachfolger des ARToolKits. Das bedeutet es basiert im Grunde auf der Funktionsweise und den Algorithmen des älteren Systems. Wobei jedoch auch verschiedene Algorithmen verändert, erweitert und ergänzt wurden, um die Möglichkeiten für Augmented-Reality-Anwendungen auszuweiten.
Des Weiteren handelt es sich bei dem ARToolkitPlus nicht um eine zusammenstellbare Komplettlösung, wie es beim ARToolKit der Fall ist. Es werden weder eine Videoanbindung, noch werden Algorithmen zur grafischen Darstellung mitgeliefert und bereitgestellt. Bei diesem AR-System handelt es sich um eine reine Tracking-Bibliothek ohne zusätzliche Werkzeuge. Aus diesem Grund richtet sich das System eher an Menschen mit Programmiererfahrung und stellt keine Schnittstelle für eine angenehme User Experience dar.
Verwandte Programme
Durch seine Funktionsweise hat das ARToolKit den Weg für viele weitere Augmented-Reality-Anwendungen geebnet und erweiterte Anwendungsmöglichkeiten ermöglicht. Beispielsweise konnte durch das ARToolKit die Anwendung ARDesktop entwickelt werden. Diese ist eine ARToolKit-Klassenbibliothek, die eine dreidimensionale Desktop-Oberfläche mit Steuerelementen und Widgets erstellt. Dieses ist jedoch momentan nur für Windows erhältlich.
Ebenso wurde die Anwendung osgART herausgebracht. osgART kombiniert Computer Vision-basierte Tracking-Bibliotheken mit der 3D-Grafikbibliothek OpenSceneGraph. Es ermöglicht auch Programmieranfängern oder Laien eine komplexere dreidimensionale Augmented Reality aufzustellen. Es ist ebenfalls ein Open Source Programm, welches kostenfrei erhältlich ist.
Du planst eine VR-, MR- oder AR-Anwendung – hast aber noch Fragen zur Umsetzung?
Ob grobe Idee oder konkretes Konzept: Als XR-Experten bieten wir dir eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir begleiten dich gerne – von der Beratung bis zur professionellen Umsetzung.
Du interessierst dich für die Entwicklung einer VR oder AR Applikation? Du hast vielleicht schon eine konkrete Idee oder bist noch auf der Suche nach Inspiration? Mache heute den ersten Schritt und erhalte Antworten auf deine Fragen:
Unsere VR-Experten helfen dir gerne bei einer unverbindlichen Einschätzung deines Projekts! Erfahre jetzt alles was du wissen musst, um deine Firma oder Organisation in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität zu führen. Es lohnt sich!
Was ist eine Point Cloud?
Dezember 6, 2021Point Cloud,CloudGlossar
Die Point Cloud ermöglicht die Interpretation und Darstellung von 3D-Bildern. Es handelt sich dabei um eine Vielzahl an Punkten, die eine bestimmte Position in einem dreidimensionalen Raum beschreiben. In Kombination können diese Daten reale 3D-Bilder darstellen, die sich beispielsweise zu Planungszwecken einsetzen lassen.
Was sind Point Cloud Daten?
Die Point Cloud wird in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt: vom Maschinenbau über Entwicklungsprozesse neuer Produkte bis hin zur Geländemodellierung. Die Punktwolkendaten stellen die Grundlage für die Visualisierung von realen Objekten, Landschaften oder Räumen dar, die dann per OLED, QLED oder in Showrooms dargestellt werden können. Jeder Punkt besteht aus zwei Koordinaten und bezieht sich gleichzeitig auf eine vorgegebene Position im dreidimensionalen Raum. Damit unterscheidet sie sich von einer LiDAR Koordinate, die zusätzlich zu den Werten X und Y den Höhenwert (Z) beinhaltet.
Um ein 3D-Objekt oder eine Umgebung ideal darstellen zu können, werden in der Regel Millionen von Punkten benötigt. Liegen diese im gewünschten Format vor, können sie mithilfe einer Software entsprechend umgewandelt und angezeigt werden.
Wie werden die Daten für die Punktwolke erfasst?
Um die Point Cloud Daten zu erfassen, müssen moderne Technologien zum Einsatz kommen. Zwar ist es möglich, klassische topografische Verfahren zu verwenden, doch wären diese ausgesprochen zeitaufwendig. Die Lösung dafür ist die Light Detection and Ranging Technologie (LiDAR). Mit ihr können Entfernungen und Abmessungen mithilfe der Lichtimpulse eines Lasers gemessen werden.
Dabei misst ein sehr genauer Timer, wie lange der Lichtstrahl benötigt, um von einem Objekt reflektiert zu werden. Entscheidend ist die Zeit zwischen dem Aussenden und dem Zurückprallen auf dem LiDAR-Sensor: Aus ihr lässt sich die Entfernung zwischen dem Sensor und dem Objekt errechnen. Anschließend wird der Punkt der Point Cloud hinzugefügt und kann mit einer 3D-Software visualisiert werden.
Aufgrund der hohen Dichte an Daten können Ausreißer ignoriert werden. Dadurch ergibt sich ein aussagekräftiges Datenmodell, das für unterschiedlichste Vorhaben eingesetzt werden kann.
Alternative Methoden
Eine Alternative zur Erfassung per LiDAR ist die Photogrammetrie. Dabei werden Fotos aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen. Je höher die Überlappungen dieser Bilder, desto dichter und genauer kann die Point Cloud ausfallen. Anders als Beim LiDAR werden die Punkte aus den Bildern berechnet und anhand ihrer RGB-Werte eingefärbt. Diese Vorgehensweise ist deutlich günstiger als die Aufnahme per Sensor, allerdings auch ungenauer. Welche Methode sich am besten für die Point Cloud eignet, hängt von dem jeweiligen Einsatzgebiet ab.
Einsatzgebiete der Point Cloud
Der klassische Anwendungsfall einer Point Cloud ist die Modellierung eines aufgenommenen Geländes. Dabei kann es sich um freie Flächen wie auch um Städte oder spezielle Elemente wie eine Autobahn handeln. Dieses digitale Modell lässt sich anschließend visualisieren und für spezielle Planungsaufgaben einsetzen. Je mehr Punkte vorliegen, desto genauer und detailgetreuer kann das jeweilige Gelände modelliert werden.
Mittlerweile wird die Point Cloud allerdings auch für modernere Einsatzgebiete verwendet: Sie kann beispielsweise eine Virtual-Reality Umgebung manipulieren oder für Testzwecke eingesetzt werden. So können Sicherheitslücken oder geplante Vorhaben direkt in der digitalen Welt getestet werden, was deutlich günstiger und sicherer ist. Das macht die Point Cloud für Bauvorhaben in jeglicher Größenordnung zu einem wertvollen Hilfsmittel.
Selbst die beweglichen Teile von Fahrzeugen lassen sich mithilfe der Punktwolke visualisieren und testen. Projektmanager können auf diese Weise feststellen, ob die bestehenden Strukturen wie gewünscht reagieren. Alternativ lässt sich dadurch herausfinden, wie besagte Elemente mit neuen Features interagieren oder ob sich die Änderungen negativ auf das vorhandene Produkt auswirken.
Die breitgefächerten Einsatzmöglichkeiten machen die Punktwolke in vielen Bereichen zur Grundlage für lösungsorientierte und zukunftsorientierte Weiterentwicklungen. Gleichzeitig lassen sich mit ihrer Hilfe Risiken erkennen. Dadurch können Lösungen gefunden werden, noch bevor das jeweilige Problem eintritt. Im besten Falle ist die Point Cloud also lebensrettend. Zwar lassen sich dieselben Aussagen mithilfe einer klassischen Vermessung treffen, doch zeigt sich die Point Cloud als deutlich effizienter und zukunftsorientierter.
Du planst eine VR-, MR- oder AR-Anwendung – hast aber noch Fragen zur Umsetzung?
Ob grobe Idee oder konkretes Konzept: Als XR-Experten bieten wir dir eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir begleiten dich gerne – von der Beratung bis zur professionellen Umsetzung.
Du interessierst dich für die Entwicklung einer VR oder AR Applikation? Du hast vielleicht schon eine konkrete Idee oder bist noch auf der Suche nach Inspiration? Mache heute den ersten Schritt und erhalte Antworten auf deine Fragen:
Unsere VR-Experten helfen dir gerne bei einer unverbindlichen Einschätzung deines Projekts! Erfahre jetzt alles was du wissen musst, um deine Firma oder Organisation in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität zu führen. Es lohnt sich!
Was bedeutet Scrum?
Dezember 6, 2021QLED,LED,OLED,Samsunf,Quantum Dots,Bildschirm,MonitorGlossar
Scrum ist eine der bekanntesten Methoden in der agilen Softwareentwicklung. Es handelt sich dabei um ein Framework, das gleichermaßen für die Produktentwicklung und das Projektmanagement eingesetzt wird. Seinen Ursprung hat die Methodik in der Softwareentwicklung, wobei sich die Werte und Abläufe grundsätzlich in jedem Projekt nutzen lassen.
Was ist Scrum?
Der Begriff Scrum stammt aus dem Englischen und bedeutet „angeordnetes Gedränge“. Die Methode beschreibt ein Rahmenwerk, das vorschlägt, wie Teams am besten zusammenarbeiten, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die Interaktion steht also im Mittelpunkt. Zu diesem Zweck werden verschiedene Rollen, Meetings und Tools definiert, die in Kombination zu einem definierten Arbeits- und Entwicklungsprozess beitragen.
Demnach handelt es sich nicht um eine dogmatische Methode, die sich Schritt für Schritt durchführen lässt, sondern um ein Framework. Es dient sowohl dem Team als auch den Stakeholdern als Rahmengerüst für die Kommunikation und Zusammenarbeit und definiert die wichtigsten Orientierungspunkte.
Seit wann gibt es Scrum als Methode?
Zum ersten Mal wurde die Scrum Methode auf einer Konferenz im Jahr 1995 vorgestellt. Ihre Begründer Jeff Sutherland und Ken Schwab entwickeln sie bis heute permanent weiter, sodass sie weiterhin das Verständnis der agilen Arbeitsweise prägt. Das „Agile Manifest“, dass die Grundlagen von Scrum verdeutlicht, wurde 2001 ausformuliert.
Welche Prinzipien stehen hinter dem Framework?
Grundsätzlich orientieren sich die Scrum Prinzipien an den Werten der agilen Entwicklung. Ohne diese Leitvorstellungen ist es nicht möglich, gemäß der Scrum Methode zu arbeiten.
- Autonomie: Entwicklungsteams arbeiten selbstbestimmt und selbstorganisiert.
- Feedback: Ein regelmäßiges Feedback von Anwendern, Kunden und Stakeholdern erlaubt die kontinuierliche Verbesserung. Gleichzeitig erfolgt ein regelmäßiges Feedback innerhalb des Teams, um die Zusammenarbeit zu stärken.
- Fokus: Zu erledigende Aufgaben werden konsequent priorisiert, um einen hohen Fokus zu schaffen.
- Prozesstreue: Die hohe Standardisierung trägt zu einer hohen Transparenz bei, weshalb die einzelnen Bestandteile des Scrum Prozesses nicht verhandelbar sind.
- Transparenz: Aufgaben, Entscheidungen und Ziele stehen allen Beteiligten und allen Stakeholdern stets frei zugänglich zur Verfügung und sind allgemein bekannt.
- Vision: Das Team folgt einem übergreifenden Orientierungspunkt in Form eines langfristigen Ziels.
- Wert: Messbare Ergebnisse beziehen sich für die Teams stets auf den erzielten Wert für das Unternehmen oder den Kunden.
Wie ist das Framework aufgebaut?
Das Scrum Framework basiert auf drei Säulen: Rollen, Meetings und Artefakten. Die Rollen beschreiben die Verantwortlichkeit innerhalb des Projektes und setzen sich aus dem Product Owner, dem Entwicklungsteam und dem Scrum Master zusammen. Zwar dürfen Stakeholder ebenfalls in einige Punkte einbezogen werden, doch haben sie mit dem Framework an sich nichts zu tun. Wichtig: Damit das Framework die gewünschten Ergebnisse bieten kann, darf sich das Entwicklerteam lediglich aus drei bis acht Personen zusammensetzen.
Die Meetings beschreiben die wiederkehrenden Aktivitäten, die unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Grundlage ist dabei stets der Sprint, der den Entwicklungszeitraum festlegt. Losgelöst davon sollte das Daily maximal fünf bis 15 Minuten in Anspruch nehmen.
Die Artefakte sind wichtige Werkzeuge im Framework. Dazu gehören beispielsweise das Sprint Goal, die Definition of Done, die User Stories und das Sprint Backlog. Die Artefakte bedingen einander mehr oder weniger abhängig davon, in welchem Zusammenhang sie zu den jeweiligen Tasks oder Sprints stehen.
Das selbstorganisierte Team als Grundlage für einen erfolgreichen Prozess
Das Scrum Framework besagt, dass Teams, die selbstorganisiert arbeiten, die gewünschten Ergebnisse schneller und effizienter abliefern. Das bedeutet, die Entwickler entscheiden sich selbst, welche Aufgaben sie als Nächstes angehen. Gleichzeitig legen sie fest, wie viel sie innerhalb des kommenden Sprints schaffen können. Dabei wird die Leistungsfähigkeit des Teams ebenso berücksichtigt wie bekannte externe Faktoren. Die Grundlage für diese Entscheidungsfreiheit ist das Backlog, das vom Product Owner befüllt und priorisiert wird. In dieser Zusammensetzung entfällt also der klassische Vorgesetzte, der die Aufgaben verteilt. Vielmehr entscheidet das Team, in welcher Reihenfolge sich die geforderten Elemente am besten realisieren lassen.
Du planst eine VR-, MR- oder AR-Anwendung – hast aber noch Fragen zur Umsetzung?
Ob grobe Idee oder konkretes Konzept: Als XR-Experten bieten wir dir eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir begleiten dich gerne – von der Beratung bis zur professionellen Umsetzung.
Du interessierst dich für die Entwicklung einer VR oder AR Applikation? Du hast vielleicht schon eine konkrete Idee oder bist noch auf der Suche nach Inspiration? Mache heute den ersten Schritt und erhalte Antworten auf deine Fragen:
Unsere VR-Experten helfen dir gerne bei einer unverbindlichen Einschätzung deines Projekts! Erfahre jetzt alles was du wissen musst, um deine Firma oder Organisation in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität zu führen. Es lohnt sich!
Was bedeutet QLED?
Dezember 3, 2021QLED,LED,OLED,Samsunf,Quantum Dots,Bildschirm,MonitorGlossar
QLED ist ein Begriff aus der Bildschirmtechnik, der sich deutlich von der gängigen OLED Technologie unterscheidet. Es handelt sich um eine spürbar verbesserte Variante der bekannten LED-Technologie, die dünner und kontrastreicher ausfällt. Der Grund dafür ist, dass mehrere Schichten übereinanderliegen, wodurch besonders lebensnahe Effekte entstehen.
QLED hat nichts mit einem holografischen Display zu tun. Für einen uneingeschränkten Sehgenuss – ob beim Gaming oder beim Filmeschauen – ist ebenfalls eine geringe Latenz wichtig.
Was ist das Besondere an QLED?
Die Abkürzung QLED ist eng mit dem Hersteller Samsung verbunden, wobei auch TCL und Hisense auf diese Technologie setzen. Dabei ist der Unterschied zu OLED rein technologischer Natur. Während viele Bildschirme auf selbst leuchtende Dioden setzen, ist es in diesem Fall anders. Eine LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass die Bildpunkte beleuchtet werden. Das bedeutet: Während OLED eine eigenständige Technologie ist, entwickelt QLED die bekannte LED-Technologie weiter.
Wie ist die LED-Weiterentwicklung aufgebaut?
Bei QLED-Bildschirmen kommen die sogenannten Quantum Dots zum Einsatz. Dem „Quantum“ verdankt die Weiterentwicklung ihren Namen, der mit Q abgekürzt wird. Im Allgemeinen gelten dank dieser Quantum Dots als ausgesprochen farb- und kontraststarke LCD-Bildschirme, die meist als Fernsehbildschirme zum Einsatz kommen. Diese Dots werden mit der Liquid Crystal Display Technologie verbunden, woraus sich die Weiterentwicklung der LED-Technologie ergibt.
Sie können jedoch nicht selbst leuchten, sondern werden durch die dahinterliegende LED Schicht erhellt. Gleichzeitig sorgen elektrische Impulse dafür, dass sich die Ausrichtung der Kristalle ändert. Das bedeutet, es liegen mehrere Schichten übereinander, wobei eine von ihnen ein Polarisationsfilter ist. Zusätzlich sind ein Hintergrundfilter und ein RGB-Filter enthalten, um zu einer guten Bildqualität beizutragen. Die Kombination dieser Filter sowie die Ausrichtung der Kristalle entscheidet, wie viel Licht in jedem Moment durchgelassen wird.
Dennoch sind viele QLED-Bildschirme tendenziell kontrastärmer als die OLED Modelle. Der Grund dafür ist die dunklere Bildfläche, die durch die Hintergrundbeleuchtung leicht ausgegraut wird. Dieses Problem lösen Hersteller wie Samsung, indem sie einzelne Bereiche im Display heller ausleuchten als andere, um für eine durchgängige Beleuchtung zu sorgen.
Die wichtigsten QLED Eigenschaften
Anders als OLED benötigen Quantum Dot Bildschirme eine separate Lichtquelle in Form von Hintergrund-LEDs für die interne Beleuchtung. Durch den Einsatz verschiedener Filter wirken die Bilder heller und farbintensiver, verglichen mit einem normalen Fernsehbildschirm. Gleichzeitig zeichnet sich diese Technologie durch unterschiedliche Eigenschaften aus:
- Energieverbrauch: In der Regel verbrauchen QLED-Bildschirme mehr Energie als OLEDs, aber weniger als bloße LED-Bildschirme. Der Grund dafür ist die dauerhafte Hintergrundbeleuchtung, die für die Farbdarstellung notwendig ist.
- Helligkeit: Die Quantum Dots erlauben deutlich hellere Farben als die bloßen LED.
- Kontrast: Da die Dioden bei mehr Helligkeit keine Farbe einbüßen, steigt der Kontrast im Vergleich zur reinen LED-Technologie.
Welche Vorteile bieten die Quantum Dots?
Die Quantum Dots sind Nanokristalle, die eine besonders reine Farbfrequenz absondern. Das bedeutet, sie frischen die Lichterzeugung auf, wodurch die Farben bunter und heller wirken, als es normalerweise der Fall ist.
- Die Quantum Dots sind eine neue Technologie, die mit der bereits bestehenden Liquid Crystal Technologie Hand in Hand gehen. Es ist demnach keine technische Neuerung für die LC-Displays notwendig, um die Dots nutzen zu können.
- Die saubere Trennung der Grundfarben ermöglicht einen großen Farbraum.
- Quantum Dots absorbieren das Licht nicht, sondern wandeln es um. Das bedeutet, sie können bei gleicher Abwärme hellere Bilder darstellen, was sie perfekt für die HDR Technologie bei einem niedrigeren Verbrauch an Energie macht.
Woher stammen die Quantum Dots?
Das Patent auf die Quantum Dots hat nach wie vor der Hersteller Samsung inne. Der Begriff an sich ist vor allem auf das Marketing ausgelegt und soll die technische Raffinesse des neuen Produktes zeigen. Insgesamt finden sich unterschiedliche Q-Serien auf dem Markt, die in verschiedenen Geräteklassen unterteilt sind. Dabei unterscheiden sich die Bildqualität, der Kontrast und das Design deutlich: Sie sind abhängig von der Anordnung und der Anzahl der verbauten LED Elemente, die für die Hintergrundbeleuchtung notwendig sind.
Du planst eine VR-, MR- oder AR-Anwendung – hast aber noch Fragen zur Umsetzung?
Ob grobe Idee oder konkretes Konzept: Als XR-Experten bieten wir dir eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir begleiten dich gerne – von der Beratung bis zur professionellen Umsetzung.
Du interessierst dich für die Entwicklung einer VR oder AR Applikation? Du hast vielleicht schon eine konkrete Idee oder bist noch auf der Suche nach Inspiration? Mache heute den ersten Schritt und erhalte Antworten auf deine Fragen:
Unsere VR-Experten helfen dir gerne bei einer unverbindlichen Einschätzung deines Projekts! Erfahre jetzt alles was du wissen musst, um deine Firma oder Organisation in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität zu führen. Es lohnt sich!
Was bedeutet Metaversum?
Dezember 3, 2021Metaversum,MetaverseGlossar
Das Metaversum, auch Metaverse genannt, ist eine Verknüpfung aus der realen und den virtuellen Welten. Es handelt sich dabei um einen relativ neuen Begriff, den vornehmlich Online-Spiele geprägt haben. Es ist also ein virtueller Ort, an dem sich reale Menschen begegnen, um dort miteinander zu interagieren. Diese Erweiterung der realen Welt ist darauf ausgelegt, dass die Teilnehmer physisch in die virtuelle Welt eintauchen können.
Die Idee des Metaversums
Die grundlegende Idee hinter dem Metaversum lässt sich in wenigen Worte zusammenfassen: Sie verknüpft die getrennten Services des Internets miteinander zu einer realen Welt. Der Grund dafür ist, dass das Internet in Services unterteilt ist. Jeder Service hat seinen eigenen Handlungsraum, der nicht übergreifend genutzt werden kann. Es sind kleine abgeschlossene Einheiten, die parallel zueinander existieren, aber nicht zeitgleich von einer einzelnen Person bedient werden. Wer beispielsweise aktiv in seinem E-Mail Account beschäftigt ist, kann nicht zur selben Zeit ein Spiel auf Steam öffnen.
Die Verschmelzung der digitalen mit der physischen Welt
Es soll künftig also nicht mehr nur den virtuellen Raum geben, sondern eine komplett virtuelle Welt. Darin werden wir uns in Form von Avataren bewegen und mit digitaler Währung digitales Eigentum kaufen – und das geräteunabhängig. Schluss mit 2D! Das Metaverse soll uns nicht nur Texte lesen und Videos schauen lassen. Die User werden dreidimensional und können gemeinsam mit anderen Events interaktiv erleben. Anstatt lediglich durch die Timeline in den Sozialen Netzwerken zu scrollen, werden wir durch sie schlendern können. Klamotten könnnen wir direkt anprobieren, an Veranstaltungen wie Konzerten oder Kino direkt teilnehmen, mit den KollegInnen in Meetings sitzen oder auch Immobilien (wie zum Beispiel eine Villa oder ein Ferienhaus) besitzen können. Wir können etwa den neusten Netflix-Film besprechen, Ordner teilen oder gemeinsam auf Notizen zugreifen.
Der wichtige Aspekt ist die Interaktion mehrerer Teilnehmer innerhalb des virtuellen Raums. Gleichzeitig ist es durchaus denkbar, an realen Ereignissen über die virtuelle Welt hinweg in Echtzeit teilzuhaben. Das macht das Metaversum in vielen Bereichen zu einer wichtigen Grundlage für die persönliche, ortsunabhängige Weiterbildung. Die physische Welt wird demnach in eine digitale transferiert, in der wir uns frei bewegen können. Gleichzeitig ist es im Metaversum möglich, soziale Verantwortung zu übernehmen oder sich weiterzubilden. Zum Beispiel in der Gesundheitsbranche beim VR-gestützten E-Learning, wenn es etwa um das Anlernen von Pflegekräften, Schulungen zu Standards oder die Zusammenarbeit interdisziplinärer Teams geht. Internationale Studien belegten den positiven Effekt des Learning by doing in VR und erste Einsätze von VR-Trainings zeigten, dass hier ein großes Potenzial liege, sagt Petra Dahm, Vorstandsmitglied bei XR Bavaria, einem Fachverein für Virtual Reality und Augmented Reality.
Komplett neu sind diese Ideen und Konzepte nicht; die primäre Technologie des Metaversums ist die sogenannte Extended Reality (XR) – erweiterte Realität. Sie besteht aus Virtual Reality sowie Augmented Reality (AR). Im Metaverse kommen diese aktuellen Technologien im Prinzip zusammen und werden zu etwas Neuem und Großen. Wir könnten ein eigenes Business eröffnen, was in der physischen Welt eventuell nicht oder nur unter schwierigeren Umständen möglich wäre. Die Möglichkeiten sind um ein Vielfaches größer. Während wir uns eventuell im physischen Leben kein Haus leisten können, kann dies im Metaversum schon anders aussehen. Auch in der virtuellen Welt werden Besitzgüter immer wichtiger und auch immer wertvoller. So lassen sich nicht nur die Avatare optisch verändern, auch die virtuellen Räume können wir gestalten – mit Lampen, Sofas, Bildern etc., die uns gefallen. Dafür nehmen auch digitale Währungen eine immer immanentere Rolle ein.
Die Erweiterung der physischen Welt
Das Besondere am Metaversum ist, dass es nicht lediglich einen Transfer in die digitale Welt ermöglicht. Es erweitert gleichzeitig die physische Welt. Das wird am Beispiel von Kryptowährungen (z.B. Sandbox) klar, die sich auch auf die reale Finanzwelt auswirken und dort gehandelt werden. Zu den wichtigsten Metaverse Coins und Metaverse-Plattformen gehören:
- The Sandbox (SAND): Seit 2012 gibt es das Unternehmen Sandbox, das vor allem für das Videospiel Minecraft bekannt ist. Im Jahr 2018 stieg die Firma mit den Spielen auch in die Krypto Welt ein. SAND hat starke Kooperationen zu bieten – u.a. mit Binance und Adidias. Mit Sandbox können User NFTs als Gegenstand in der virtuellen Welt besitzen und diese sogar nach Minecraft zu verschieben.
- Decentraland (MANA): Der Metaverse Coin weist zurzeit die größte Marktkapitalisierung auf. Die MANA Plattform erschafft für seine Nutzer im Prinzip eine zweite virtuelle Welt mit zahlreichen Funktionen. Mit virtuellen Casino-Besuchen, virtuellem Shopping oder einer virtuellen Unternehmensbildung bietet die Plattform somit alle Erlebnisse, die es ebenfalls im realen Leben zu erfahren gibt.
- THETA: Dabei handelt es sich um eine Plattform, die anstatt eines zentralen Servers ein dezentrales Netzwerk aufbaut. Die User dienen dabei als Knotenpunkt (Node), der Bandbreite für die Plattform zur Verfügung stellen kann.
Zudem kann man seine physische Welt etwa mithilfe von Augmented Reality erweitern, in der man beispielsweise einen Avatar oder seinen NFT bei sich Zuhause sehen kann.
Dezentralität ist der Schlüssel
Im Metaverse existieren keine Plattformen wie etwa im Web 2.0, über die alles abläuft. Es funktioniert komplett dezentral und geräteunabhängig. Ob über Laptop, PC, Tablet oder Smartphone: Jeder kann sich neue Welten und Räume erschaffen. Und Jeder kann entscheiden, wohin er sich mit seinem Avatar begibt und mit wem er interagiert. Das sorgt nicht nur für eine Unabhängigkeit von Endgeräten, sondern auch von großen Tech-Konzernen. Dabei spielt die Blockchain eine zentrale Rolle, die man schon aus dem Bereich der Kryptowährungen kennt. Menschen interagieren, kommunizieren und handeln ohne Vermittler(-Plattform) direkt miteinander und erhalten die Möglichkeit, die Hoheit über ihre Daten zu behalten.
Metaversum: Woher stammt der Begriff?
Der Begriff Metaverse stammt aus dem Science-Fiction-Roman „Snow Crash“ von Neal Stephenson aus dem Jahr 1992. Darin beschreibt der Autor in einer nicht allzu fernen zukunft eine computergenerierte virtuelle Welt, die durch Software und ein weltweites Glasfasernetz ermöglicht wird.
Der Begriff Metaversum setzt sich aus den Wörtern „Meta“ und „Universum“ zusammen. Das englische Pendant ist die Bezeichnung Metaverse, die dieselbe Aussage beinhaltet. Es ist ein Kofferwort, das gleichzeitig auf das Werden des Metaversums hinweist. Der Grund dafür: Es handelt sich nicht ausschließlich um Spielewelten, sondern um reale Räume, die über das Internet – etwa in Form eines Webbrowsers – betreten werden können.
Dabei kommen unterschiedliche Entwicklungsansätze zum Tragen, die sich einander iterativ annähern. So soll es künftig möglich sein, sich Informationen über reale Ereignisse innerhalb der Virtual Reality zu holen, um diese in der physischen Umwelt nutzen zu können. Dadurch verschmelzen die physische und die virtuelle Welt scheinbar miteinander.
Das Metaverse ist noch in Entwicklung
Die Entwicklung des Metaversums ist noch nicht abgeschlossen. Allerdings interessieren sich die Entwickler bereits seit den 1980er-Jahren für dieses Vorhaben und arbeiten in letzter Zeit verstärkt daran. Die modernen Techniken der Augmented Reality sind eine entscheidende Grundlage für die Weiterentwicklung und besonders erfolgversprechend. Denn: Eine solche AR-Brille ermöglicht die Konvergenz zwischen virtueller und physischer Realität.
Trotzdem ist diese Annäherung nicht ausreichend für die Schaffung des Metaversums. Dafür bedarf es der Verschmelzung der erweiterten Realität mehrerer virtueller Räume und unterschiedlicher Online-Games. Nur dadurch ist es möglich, sich zwischen verschiedenen virtuellen Welten hin und her zu bewegen.
Wichtig ist jedoch: Das Metaversum ist kein finaler Zustand. Es ist in ständiger Bewegung und wird sich auch in Zukunft immer weiterentwickeln. Ein genaues Startdatum für das Metaversum gibt es demnach nicht. Der Begriff wurde in den vergangenen 20 Jahren geprägt und hat sich ständig weiterentwickelt. Bereits 1985 wurden erste Versionen des Metaversums geschaffen.
Welche Beispiele gibt es für das Metaverse?
Das Metaversum ist bereits seit Jahren im Gespräch, wenngleich der Name verhältnismäßig neu ist. Beispielsweise hat das Spiel Habitat schon im Jahre 1985 ein solches Metaversum geschaffen, wenn auch ein schwach vernetztes. Das Buch Ready Player One aus dem Jahr 2011 befasst sich ebenfalls mit dem Thema Metaverse wie die Matrix-Filme. Eine besondere Bekanntheit erlangte die Thematik im Jahr 2020. Der Grund: Spieler konnten in Online-Games virtuelles Land kaufen und sich den Grundbesitz anschließend virtuell übertragen lassen. Es war also die erste Möglichkeit, reale Eigentumsrechte in der virtuellen Welt anzumelden.
Diese zahlreichen Ansätze zeigen, wie lange sich die Menschen mit dieser Idee beschäftigen. Obwohl die tatsächlichen Vorteile noch nicht bekannt sind, lassen sich viele potenzielle Anwendungsfälle bereits jetzt hervorragend ersinnen. Aus diesem Grund wird die Entwicklung stetig vorangetrieben und gefördert. Schließlich soll das Metaversum ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft sein und in zahlreichen Bereichen von Nutzen sein.
Ein denkbares Beispiel für den besonderen Nutzen des Metaversums zeigt sich in der Medizin. Künftig könnten Chirurgen mit einer AR-Brille operieren, um sich zusätzliche Informationen und Patientendaten direkt anzuzeigen. Stößt besagter Chirurg auf ein Problem während der Operation, hätte er die Möglichkeit, Daten aus der Vergangenheit zurate zu ziehen – beispielsweise die Schritte, die ein Kollege durchgeführt hat, um eine ähnliche Herausforderung zu lösen. Selbiges Vorgehen ist selbstverständlich auch in technischen Bereichen denkbar: vom Maschinenbau über die Wartung von Verkehrssystemen bis hin zur Softwareentwicklung.
Neben den bereits erwähnten Sandbox, Decentraland und THETA hat auch das Unternehmen Yuga Labs ein großes Metaverse-Projekt: Otherside. Dieses war bereits für März 2022 angekündigt. Nachfolgende Spekulationen und eine Flut unbestätigter Informationen sorgten für Unischerheiten und Probleme, die angesichts des Umfangs des Projekts nicht allzu überraschend sind. Trotz des schwierigen Starts, den die NFT-Gemeinschaft nicht sonderlich wohlwollend aufnahm, scheint Otherside eine Zukunft zu haben.
Jetzt neu: der Metaverse-Workshop
Du planst eine VR-, MR- oder AR-Anwendung – hast aber noch Fragen zur Umsetzung?
Ob grobe Idee oder konkretes Konzept: Als XR-Experten bieten wir dir eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir begleiten dich gerne – von der Beratung bis zur professionellen Umsetzung.
Du interessierst dich für die Entwicklung einer VR oder AR Applikation? Du hast vielleicht schon eine konkrete Idee oder bist noch auf der Suche nach Inspiration? Mache heute den ersten Schritt und erhalte Antworten auf deine Fragen:
Unsere VR-Experten helfen dir gerne bei einer unverbindlichen Einschätzung deines Projekts! Erfahre jetzt alles was du wissen musst, um deine Firma oder Organisation in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität zu führen. Es lohnt sich!
Smartglasses
Dezember 3, 2021Virtual Reality,Augmented Reality,Smartglasses,AR-BrilleGlossar
Aus dem Englischen wörtlich mit „intelligente Brillen“ übersetzt, sind Smartglasses in Deutschland schlicht als Datenbrillen bekannt. Und ihr Bekanntheitsgrad steigt: Seit der Markeinführung durch Goolge im Jahr 2014 nutzen sie immer mehr Unternehmen als Option. Und zwar, um über die tragbaren elektronischen Geräte virtuelle Informationen in reale Umgebungen einzuspielen.
Was sind Smartglasses?
Unter Smartglasses versteht man also tragbare Computerbrillen. Diese projizieren die gewünschten Informationen in das Sichtfeld des Trägers, um damit die Wirklichkeit um digitale Elemente ergänzen. Als Alternative ist beim sogenannten Virtual Retinal Display das Lichtfeld als Rasterbild direkt auf der Netzhaut angezeigt. Die Einblendungen erscheinen als schwebende Displays, die Smartglasses selbst werden aufgrund ihrer als Augmented Reality bezeichnete Realitätserweiterung auch AR-Brillen genannt.
Wie funktionieren AR-Brillen?
Zum Darstellen der virtuellen Wirklichkeit sind Smartglasses mit optischen Sensoren ausgestattet. Diese erfassen die Umgebung des Brillenträgers und leiten Größe und Positionierung sämtlicher geometrischen Objekte als Datensatz an den Minicomputer weiter. Die Informationen werden über einen Algorithmus implementiert, als Betriebssysteme sind vielfach Windows oder Android eingesetzt. Das Steuern der Datenbrillen erfolgt modellabhängig über Gesten oder per Sprachbefehl, die Hände des Nutzers bleiben frei.
Seit wann gibt es Smartglasses?
Die erste Datenbrille, die für weltweites Aufsehen sorgte, wurde 2014 vom US-Konzern Google auf den Markt gebracht. Die Kamera war in den Brillenrahmen eingelassen und erlaubte Usern den Zugriff auf sämtliche Google-Produkte. Andere Entwicklungen folgten zunächst alle mit dem Fokus auf Privatanwender. Durch Virtual Reality konnten die Brillenträger ihre Wohnzimmer mit Möbelhologrammen einrichten, mit Avataren kommunizieren oder Entertainment-Möglichkeiten zum Gaming nutzen. Doch der bahnbrechende Erfolg blieb aus. Stattdessen wuchs das Interesse von Unternehmen an AR-Brillen und ihren vielfältigen Vorteilen für Schulungen, Reparaturen und weiteren Arbeitsanwendungen.
Welche Vorteile bieten Datenbrillen?
Bewährt hat sich die innovative Technologie bereits in der Fahrzeugbranche. Als Head-up-Display in Kraftwagen integriert, erhalten die Fahrer wichtige Informationen über die Windschutzscheibe. Datenbrillen bieten einen weiteren Pluspunkt durch ihre kompakte Form und problemlosen Transport.
Durch das Eintauchen in die durch den Computer generierte audiovisuelle Wirklichkeit profitieren Nutzer gleich in mehrfacher Hinsicht. Der Rückgriff auf Tablets und Co. entfällt, umständliches Suchen von Informationen bleibt erspart, Aufgaben lassen sich dank digitaler Navigation in Echtzeit besonders effizient ausführen.
Wo werden Datenbrillen eingesetzt?
Immer mehr Unternehmen nutzen Smartglasses für interne Vorgänge wie auch Serviceleistungen im Kundenverkehr. Unter anderem in den folgenden Bereichen finden Smartglasses bereits erfolgreich Einsatz:
- Maschinen- und Anlagenbau: Dank Smartglasses lassen sich Maschinen und Anlagen aus der Entfernung warten. Techniker erkennen durch die Übertragung der Kamerabilder die genaue Umgebung des Mitarbeiters vor Ort. Sie können diesen per Sprachverbindung und das Einblenden von Informationen über das Mini-Display zur Reparatur anleiten. So gelingt das Unterstützen aus der Ferne.
- Logistik und Kommissionierung: Beim Lagern, Zusammenstellen und dem Transportieren von Waren leisten Datenbrillen einen bedeutenden Beitrag zur Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse. Sind aller benötigten Daten in den tragbaren Minicomputer eingegeben, informiert er die Mitarbeiter durch Einblendungen im Display. Beispielsweise über Ort, Menge und Artikelnummern. Anschließend leitet die AR-Brille sie digital durch den gesamten Prozess bis zum Einstellen oder Entnehmen von Produkten. Durch die abschließende Bluetooth-Verifizierung des Vorgangs entfallen aufwendige Bearbeitungen, erfolgen Abläufe automatisiert und Abwicklungen papierlos. Auch Transparenz und Sicherheit sind gewährleistet; vor allem bei pharmazeutischen Produkten und der Abfüll- und Verpackungstechnik ein bedeutender Faktor.
- Mitarbeiterschulungen: Durch den Einsatz von Smartglasses für Mitarbeiterschulungen werden Reise- und Übernachtungskosten gespart. Ebenso lassen sich Teilnehmeranzahlen beliebig erhöhen und Interaktivitäten zwischen Mitarbeitern fördern. Gefährliche Arbeitssituationen können simuliert und die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit von Produkten virtuell überprüft werden.
- Biofeedback: Über das Einspielen hilfreicher Informationen in das Brillendisplay hinaus lassen sich Smartglasses auch mit sogenannten Miniatur-Inertialsensoren ausstatten. So lassen sich die Muskel-Skelett-Belastungen während rückenbelastender Tätigkeiten in Echtzeit darstellen und Wirbelsäulenbelastungen langfristig reduzieren.
Wie sicher sind Datenbrillen?
Wie bei vielen innovativen Techniken spielt auch bei Smartglasses der Datenschutz eine bedeutende Rolle. Vermehrt äußerten Anwender bereits Bedenken wegen möglicher Eingriffe in die Privatsphäre Dritter durch Gesichtserkennung oder das Aufzeichnen von Unterhaltungen.
Welche Datenbrillen sind derzeit auf dem Markt erhältlich?
Kaum eine namhafte Firma möchte sich den möglichen künftigen Run auf Smartglasses entgehen lassen. Während Apple noch in den Startlöchern steht, sind Modelle anderer Hersteller bereits erhältlich:
- HMT-1 von RealWear: In so gut wie allen Industriebereichen lässt sich sie robuste, staubdichte und strahlwassergeschützte Brille verwenden. Sie kann über Schutzhelmen auch bei Extremtemperaturen getragen werden, das Display ist klappbar.
- Google Glass Enterprise Edition 2: Mit 80 Gramm ist die für Business-Anwendungen entwickelte Datenbrille besonders leicht. Sie erlaubt eine komfortable Nutzung auch über einen längeren Zeitraum. Arbeitsanweisungen sind in Wort oder Bild direkt im Bildschirm eingespielt.
- HoloLens 2: Die zweite Generation der Microsoft-Datenbrille punktet mit Tiefensensoren und der Einbindung von künstlicher Intelligenz. Die hochentwickelten Sensoren erlauben ein besonders präzises Abtasten der Umgebung und eine detaillierte dreidimensionale Darstellung.
- Magic Leap 1: Die Datenbrille des US-amerikanischen Unternehmens für Head-Mounted Displays überzeugt mit einer optimalen grafischen Leistung. Und ebenso mit einer einfachen Bedienbarkeit der Benutzeroberfläche.
- Vuzix Blade: Per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, erscheinen auf der Datenbrille eingehende Nachrichten und Terminerinnerungen. Die Steuerung erfolgt über ein Touchpad oder den eingebauten Sprachassistenten.
Was hält die Zukunft für Smartglasses bereit?
In der Industrie 4.0 gewinnen Smartglasses zunehmend an Popularität. Fehler lassen sich virtuell entdecken und aus der Ferne beheben, Papierlisten durch digitale Dokumentationen ersetzen, Experten zu Aufträgen hinzuziehen. Allerdings sind sich Experten uneins, ob sich das Nischenprodukt auch unter Privatanwendern durchsetzen wird. Herausforderungen wie Wärmeentwicklung und der Energieverbrauch stehen dem Wunsch nach Bequemlichkeit, intuitiver Bedienung, moderner Optik und einem wirklichen Mehrwert gegenüber.
Du planst eine VR-, MR- oder AR-Anwendung – hast aber noch Fragen zur Umsetzung?
Ob grobe Idee oder konkretes Konzept: Als XR-Experten bieten wir dir eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir begleiten dich gerne – von der Beratung bis zur professionellen Umsetzung.
Du interessierst dich für die Entwicklung einer VR oder AR Applikation? Du hast vielleicht schon eine konkrete Idee oder bist noch auf der Suche nach Inspiration? Mache heute den ersten Schritt und erhalte Antworten auf deine Fragen:
Unsere VR-Experten helfen dir gerne bei einer unverbindlichen Einschätzung deines Projekts! Erfahre jetzt alles was du wissen musst, um deine Firma oder Organisation in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität zu führen. Es lohnt sich!
Feedback
Dezember 3, 2021Feedback,Rückmeldung,Rückkopplung,Informationsverarbeitung,ITGlossar
Der Begriff Feedback, auch als Rückkopplung oder Rückmeldung bezeichnet, beschreibt einen Mechanismus, der in informationsverarbeitenden oder signalverstärkenden Systemen zum Einsatz kommt. Dabei wird eine Ausgangsgröße ausgesendet, die in modifizierter Form in das System zurückgeführt wird.
Das Feedback selbst gehört zu den komplexen Systemen und bildet den Teil einer Kette, die entweder eine Schleife oder eine Schaltung darstellen kann.
Woher kommt das Konzept des Feedbacks?
Grundsätzlich stammen die Konzepte der Selbstregulierungsmechanismen aus der Antike, wobei die Grundzüge des Feedbacks im 18. Jahrhundert als universelle Abstraktion niedergeschrieben wurden. Obwohl der Begriff Feedback an sich vergleichsweise neu ist, wird das dahinterstehende Konzept der Rückkopplung in seiner Funktionsweise bereits seit vielen Jahren genutzt.
Arten von Feedback
Die Rückmeldung wird in zwei Kategorien unterteilt: positiv und negativ. Eine positive Signalrückmeldung liegt immer dann vor, wenn das Signalfeedback vom Ausgang im Einklang mit dem des Eingangs steht. Bei einem negativen Feedback ist das nicht der Fall. Die Form der Rückmeldung entscheidet über die Lücke zwischen den einzelnen Parametern beziehungsweise über die Wertigkeit einer Aktion oder einer Wirkung. Welche Definition dabei zum Tragen kommt, hängt maßgeblich von der jeweiligen Disziplin ab.
Neben dem positiven und dem negativen Feedback kommen hingegen auch andere Arten vor. Das ist unter anderem in biologischen Systemen der Fall, bei denen eine bipolare Rückkopplung zwischen dem Ein- und Ausgang vorliegt.
Anwendungsbereiche der Rückmeldung
Das Konzept des Feedbacks ist in zahlreichen Disziplinen von Bedeutung, weshalb es sich durch ein breit gefächertes Anwendungsgebiet auszeichnet:
- Mathematik: In der Mathematik wird die Rückmeldung dafür genutzt, Anforderungen einer Anwendung zu erfüllen. Das ermöglicht es Systemen, reaktionsschnell, stabil und konstant gehalten zu werden.
- Biologie: In biologischen Systemen wird es in engen Bereichen eingesetzt, um optimale Werte sicherzustellen. Dabei kann es sich beispielsweise um definierte Umwelt- oder Umgebungsbedingungen handeln. Aufgrund des stark eingeschränkten Rahmens können selbst kleine Abweichungen einen Handlungsbedarf erkennen lassen.
- Maschinenbau: Bereits in der Antike wurde Feedback durch das Schwimmerventil eingeholt, das gleichzeitig den Wasserfluss der verwendeten Wasseruhren signalisierte. Heute hingegen kommt es in Form von mechanischen Rückkopplungsmechanismen zum Einsatz.
- Elektrotechnik: Für das Design elektronischer Komponenten, beispielsweise Logistikelemente, Oszillatoren oder Verstärker, sind Rückkopplungssysteme entscheidend. Sie signalisieren den Einfluss unerwünschter Änderungen und ermöglichen es, frühzeitig auf Veränderungen zu reagieren.
- Software: Im Bereich der Softwareentwicklung oder der Computersysteme stellen Rückkopplungsschleifen generische Mechanismen bereit. Diese Rückkopplungen helfen dabei, das Verhalten der Interaktion zu definieren und somit die gewünschten Systemeigenschaften zur Laufzeit sicherzustellen. Dabei wird jedoch nicht ausschließlich auf positive und negative Rückkopplungen vertraut, sondern auch auf autonome Schleifen, die von den Forschern von IBM vorgeschlagen wurden.
- Wirtschaft und Finanzen: Anders als technische Systeme unterliegen Wirtschaft und Finanzen, beispielsweise der Aktienmarkt, anderen Feedbackschleifen. Dabei wird ein verstärkter Wert auf kognitive und emotionale Faktoren gelegt, die sich in einer Steigerung oder einem Abfall einer Aktie äußern können.
Feedback: Schleife, Kette und Schwingung
Im Idealfall ist es möglich, das Verhalten innerhalb eines Systems in drei unterschiedliche Haupttypen zu unterteilen:
- Die stabile Regelung kann eine zyklische Form vorweisen, die entweder mit oder ohne Dämpfung auskommt.
- Die Verstärkung zeigt Ausreißer, die sich jedoch weiterhin in den physikalischen Grenzen des jeweiligen Anwendungsbereiches befinden.
- Die chaotische Funktion kann unter bestimmten Voraussetzungen entweder zu einer Verstärkung oder einer stabilen Regulierung führen oder diesen ähneln.
Da die Wirkung einer Rückkopplungsschleife entweder mit oder ohne Verzögerung erfolgen kann, gilt es beim Feedback auf die jeweilige Ursache zu achten. Diese kann beispielsweise vom Gerät selbst, dem System oder dem definierten Parameter beobachtet werden. Da das Konzept in unterschiedlichen Anwendungsgebieten genutzt wird, ist es stets notwendig, die erwarteten und tatsächlichen Ergebnisse in ihrem absoluten Kontext zu betrachten. Nur durch diese Kategorisierung ist eine eindeutige und zielführende Aussage über das Feedback möglich.
Du planst eine VR-, MR- oder AR-Anwendung – hast aber noch Fragen zur Umsetzung?
Ob grobe Idee oder konkretes Konzept: Als XR-Experten bieten wir dir eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir begleiten dich gerne – von der Beratung bis zur professionellen Umsetzung.
Du interessierst dich für die Entwicklung einer VR oder AR Applikation? Du hast vielleicht schon eine konkrete Idee oder bist noch auf der Suche nach Inspiration? Mache heute den ersten Schritt und erhalte Antworten auf deine Fragen:
Unsere VR-Experten helfen dir gerne bei einer unverbindlichen Einschätzung deines Projekts! Erfahre jetzt alles was du wissen musst, um deine Firma oder Organisation in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität zu führen. Es lohnt sich!
Showroom
Dezember 3, 2021Showroom,Ausstellungsraum,Produkte ausstellen,ProduktvorschauGlossar
Unternehmen oder Händler, die ihre Produkte präsentieren möchten, verwenden dazu einen sogenannten Showroom. Es handelt sich dabei um einen Ausstellungsraum, indem beispielsweise ein Designer seine neue Kollektion vorstellen kann. Auch die Präsentation von neuen Automodellen findet üblicherweise in einem Showroom statt.
Warum ist der Showroom so wichtig?
Der Showroom ist ein wichtiges Hilfsmittel für Händler und Unternehmen, da er den Customer Service in den Vordergrund stellt. Dabei sollen nicht nur preisliche Anreize gesetzt werden, sondern der Kunde soll mithilfe von Aktionen und Eindrücken in den direkten Kontakt mit den präsentierten Produkten kommen. In vielen Fällen macht die Ausstellung das Produkt lebendiger und ermöglicht es den Händlern, höhere Einnahmen zu erzielen. Der Grund dafür ist, dass der Einkauf in einem Geschäft persönlicher und interessanter ist als der Onlinekauf – nicht zuletzt wegen unterschiedlicher Vergleichsmöglichkeiten.
Im Showroom ausstellen ist nicht Showrooming
Entscheiden sich Unternehmen dafür, ihre Produkte in einem Ausstellungsraum zu präsentieren, handelt es sich dabei nicht um Showrooming. Dieser Begriff bezieht sich auf den gezielten Preisvergleich im Internet. Dieser Vergleich der Preise findet statt, während sich der Kunde innerhalb des stationären Geschäfts aufhält. Das bedeutet, er hat vor Ort die Möglichkeit, die Preise eines vergleichbaren Produktes bei der Konkurrenz zu prüfen. Dieses Vorgehen ist derzeit jedoch wenig verbreitet, da einige Händler den Vergleich mit den direkten Wettbewerbern scheuen.
Zukünftig werden digitale Showrooms immer wichtiger
Ein stationärer Showroom ist ausschließlich für eine begrenzte Anzahl an Menschen interessant. Er erfordert eine räumliche Nähe zum Ausstellungsort und setzt gegebenenfalls eine längere Anfahrt voraus. Aus diesem Grund wird die Bedeutung eines digitalen Showrooms für Unternehmen immer wichtiger. In einem solchen Showroom können die Kunden die gewünschte Ware ebenfalls prüfen, während sie nicht unmittelbar vor Ort sind. Der Unterschied ist jedoch, dass die Waren nicht direkt im stationären Handel verkauft werden, sondern über das Internet. Dieser Vorteil kommt insbesondere kleineren Unternehmen zugute oder auch solchen, die andernfalls ausladende Ausstellungsflächen anmieten müssten.
Welche Vorteile bietet ein solcher Ausstellungsraum?
Der Wunsch des Kunden, Produkte bereits im Vorfeld zu prüfen, stellt Unternehmen vor eine Herausforderung. Dabei hilft jedoch der Showroom, denn er ermöglicht den potenziellen Kunden einen tieferen Einblick als eine einfache Online-Verkaufsseite. Da ein solcher digitaler Showroom zu jeder Tageszeit aufrufbar ist, entfallen die zeitlichen Rahmenbedingungen des stationären Handels.
QR-Codes unterstützen die Verkäufe im Showroom
Als besonders profitabel gelten Showrooms dann, wenn sie Waren beinhalten, die mit einem QR-Code ausgezeichnet sind. Der Vorteil liegt darin, dass sich ein Kunde verkäuferunabhängig Produkte ansehen und einkaufen kann. Der Kauf wird anschließend direkt über das Tablet oder das Smartphone abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, beispielsweise der Ladenöffnungszeiten, ergeben sich daraus gänzlich neue Möglichkeiten für Unternehmen. Produkte lassen sich demnach wie auch beim Online-Shopping unabhängig von der Urzeit oder dem Wochentag ansehen, bestellen und bezahlen.
Du planst eine VR-, MR- oder AR-Anwendung – hast aber noch Fragen zur Umsetzung?
Ob grobe Idee oder konkretes Konzept: Als XR-Experten bieten wir dir eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir begleiten dich gerne – von der Beratung bis zur professionellen Umsetzung.
Du interessierst dich für die Entwicklung einer VR oder AR Applikation? Du hast vielleicht schon eine konkrete Idee oder bist noch auf der Suche nach Inspiration? Mache heute den ersten Schritt und erhalte Antworten auf deine Fragen:
Unsere VR-Experten helfen dir gerne bei einer unverbindlichen Einschätzung deines Projekts! Erfahre jetzt alles was du wissen musst, um deine Firma oder Organisation in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität zu führen. Es lohnt sich!